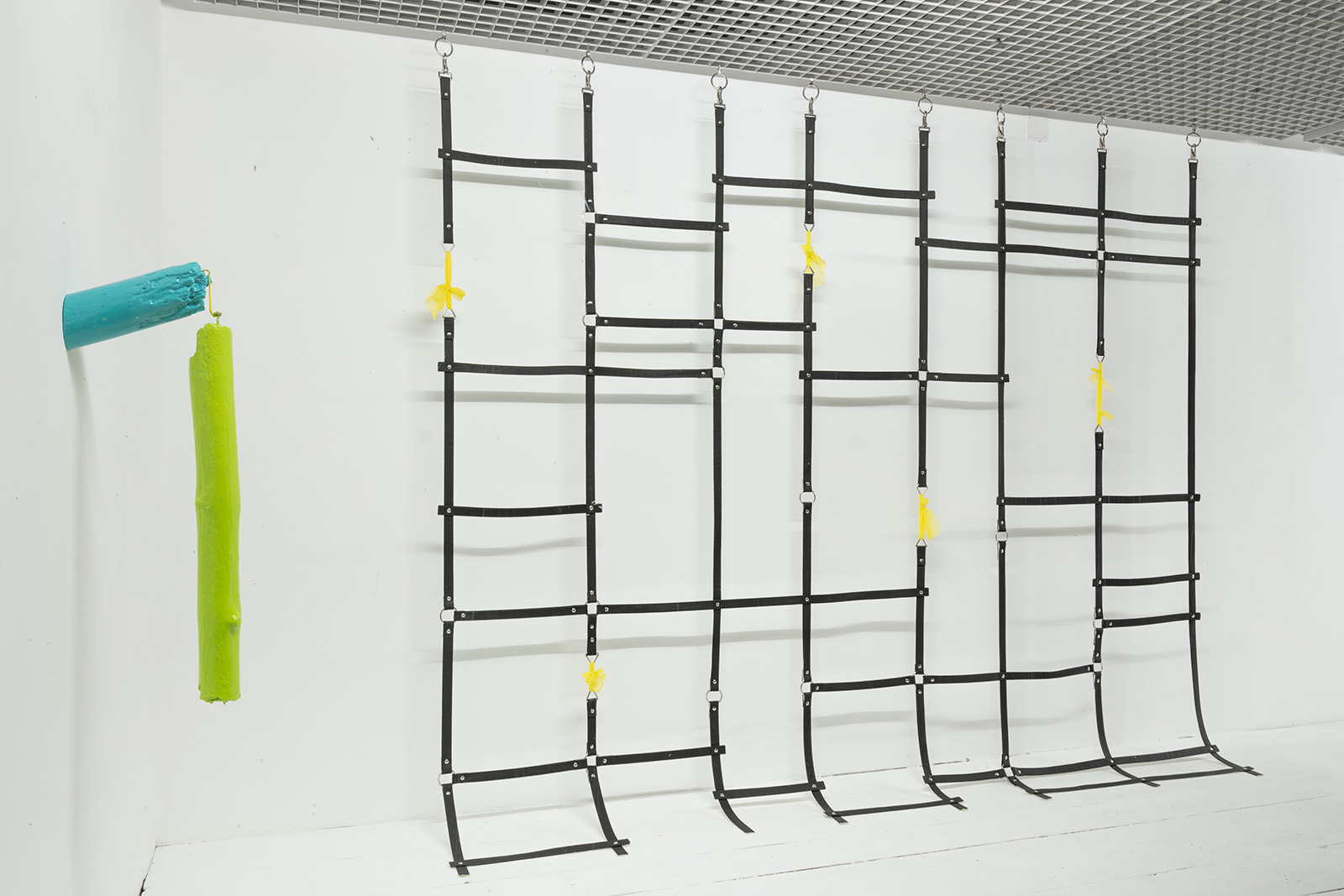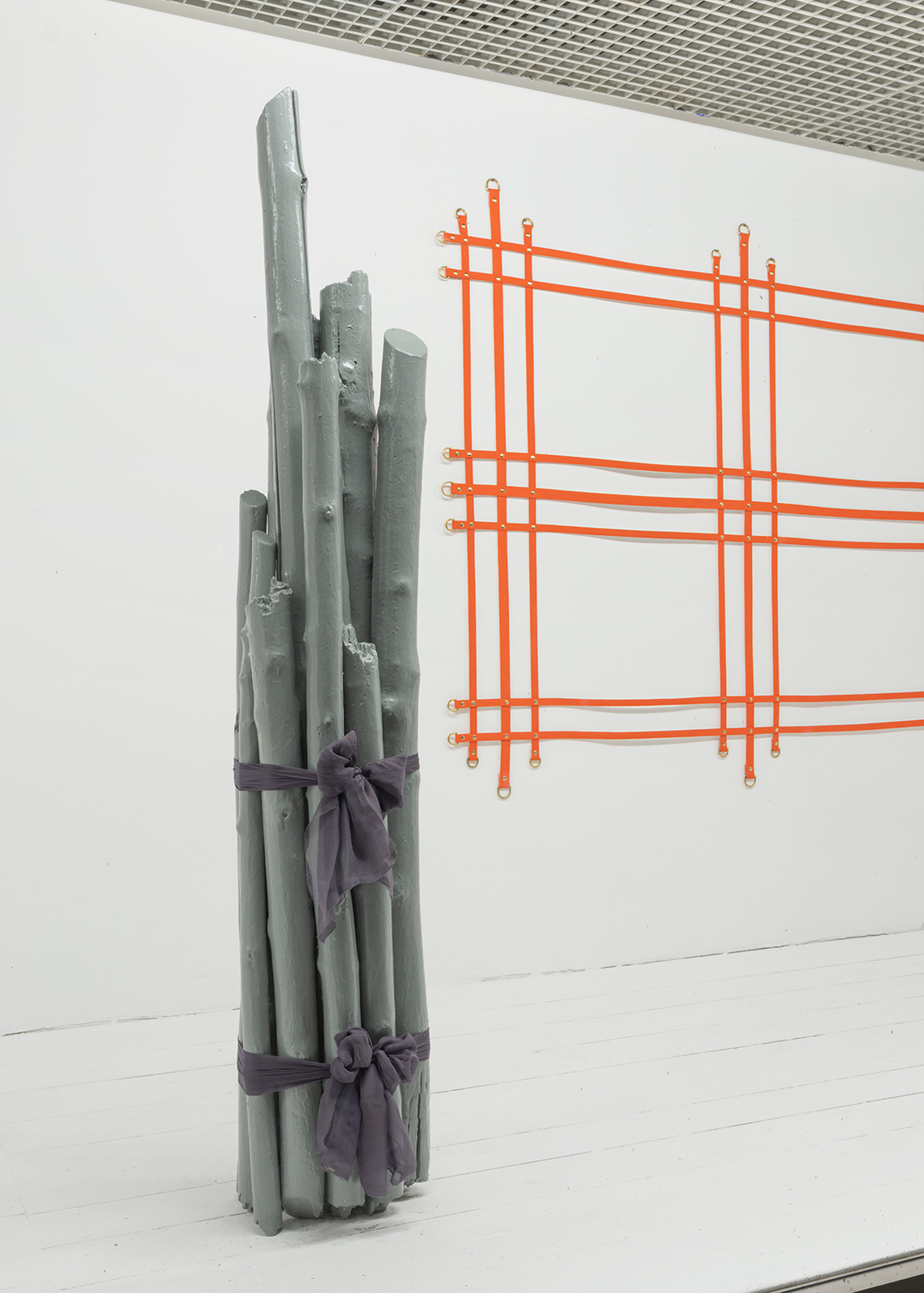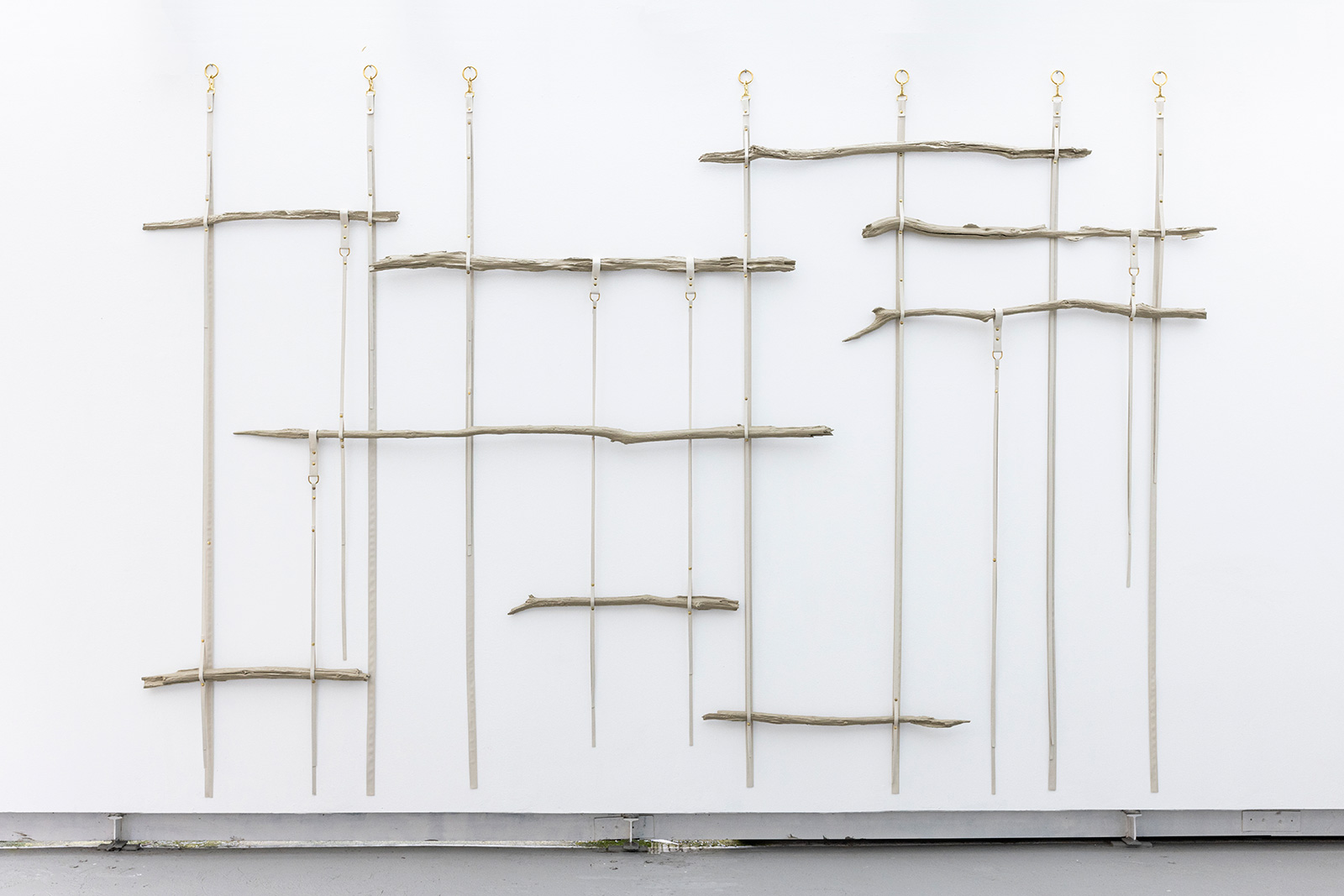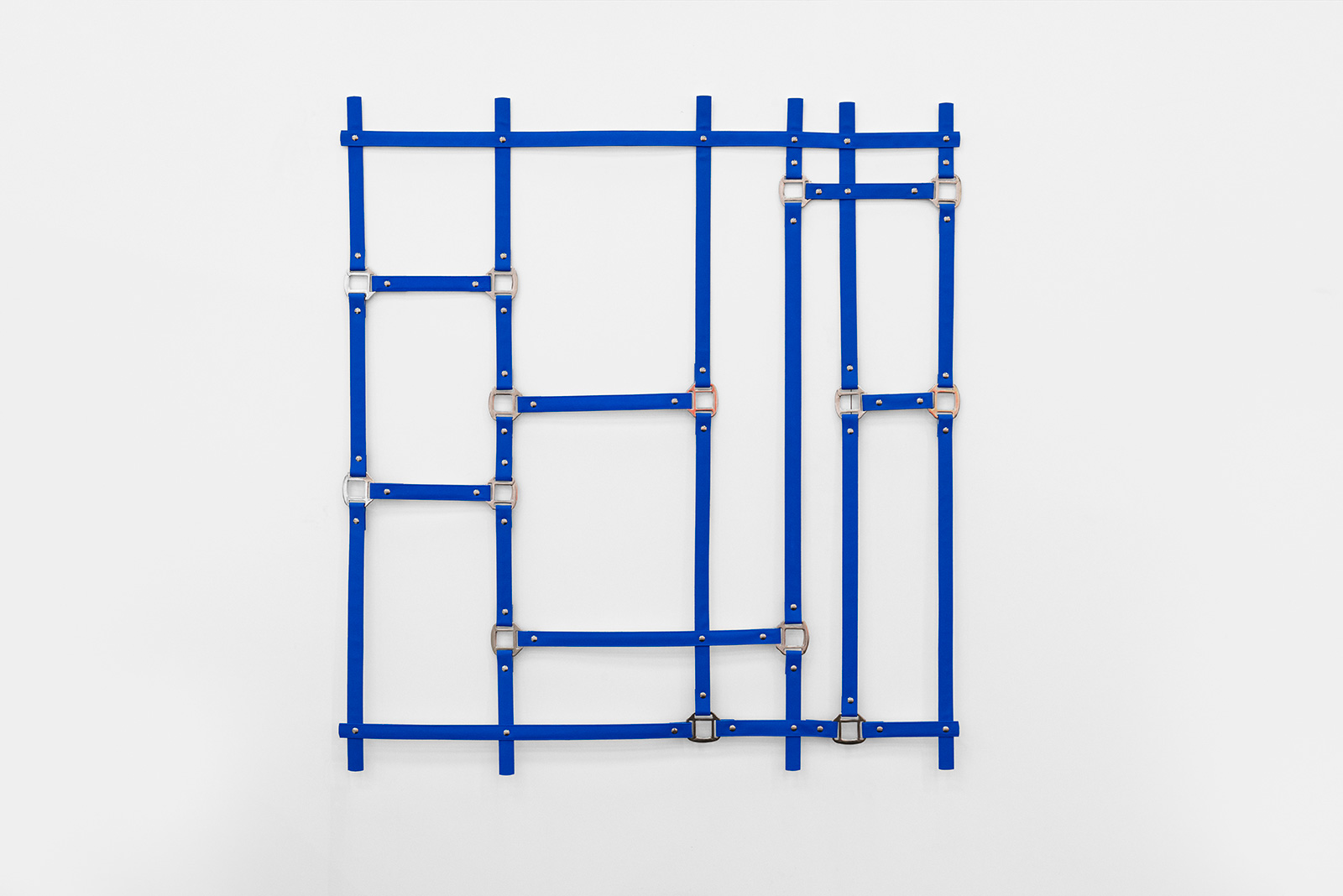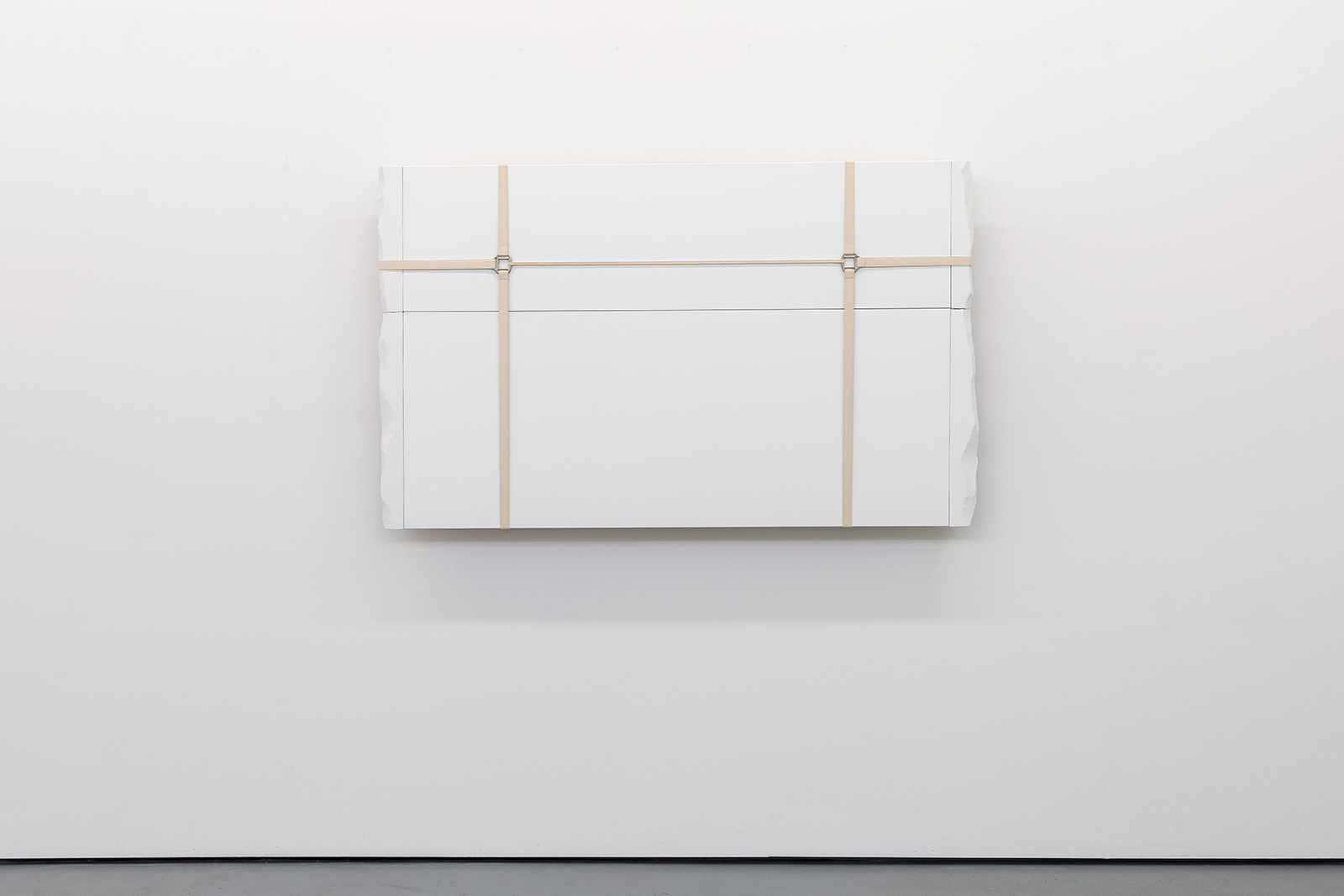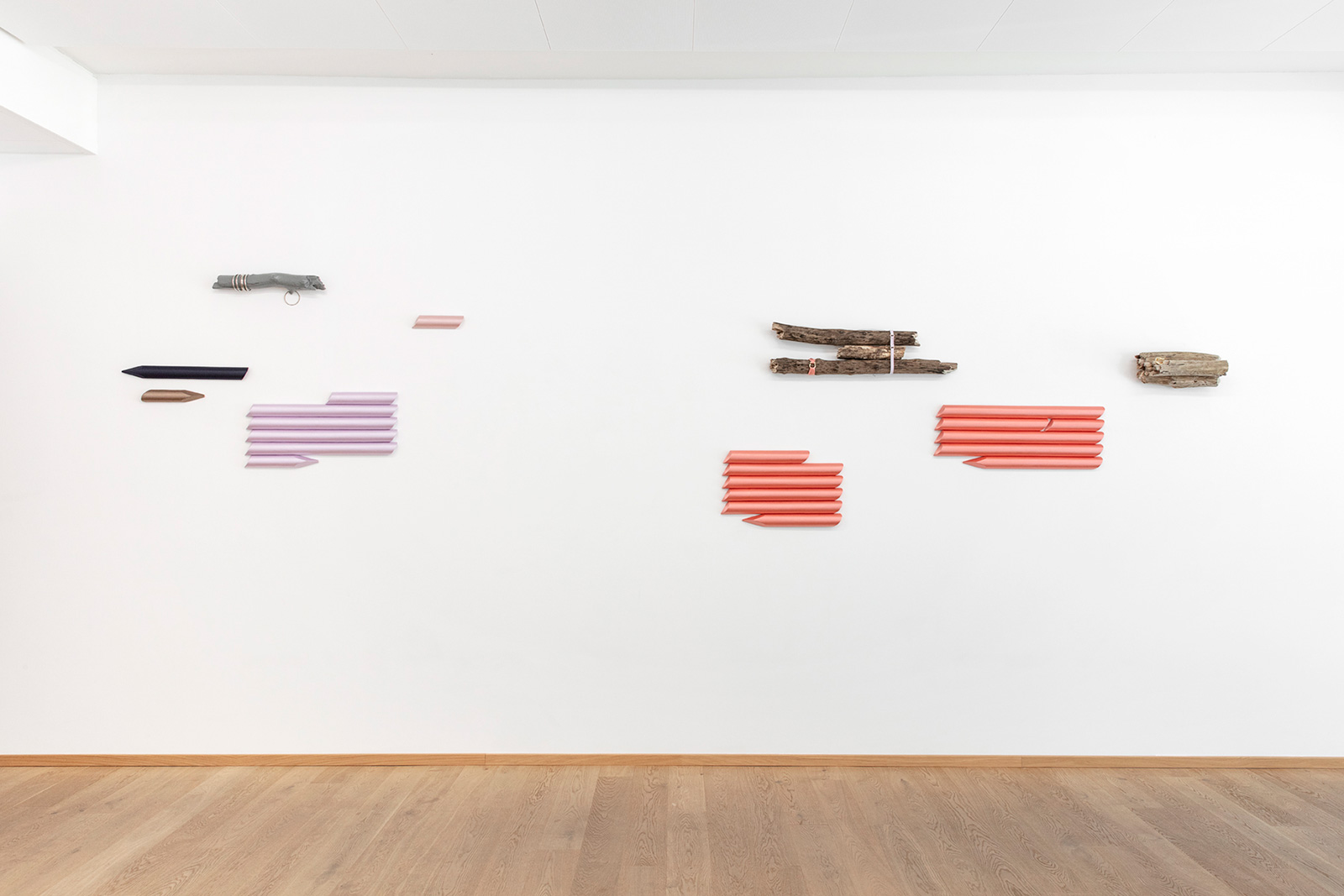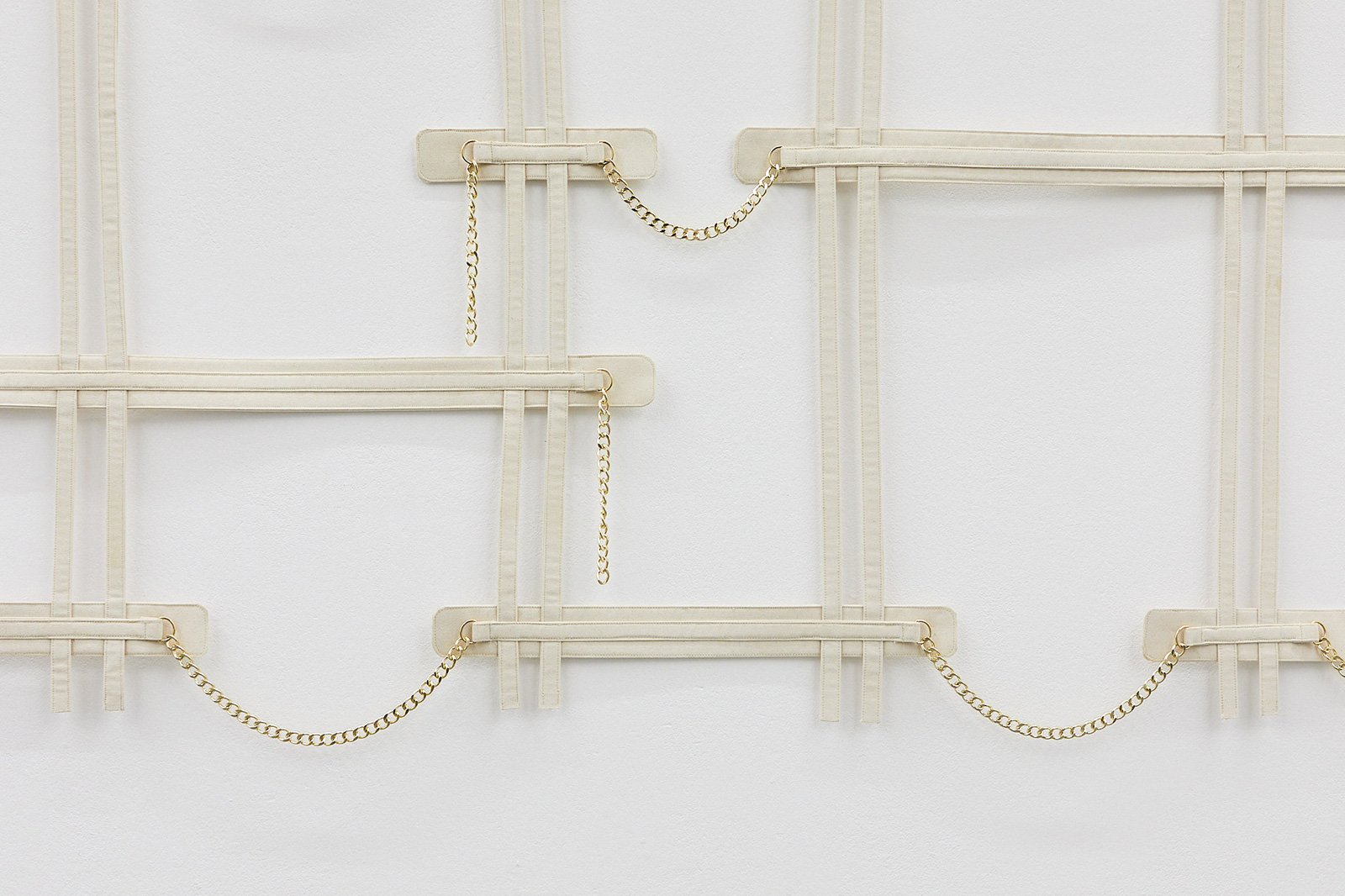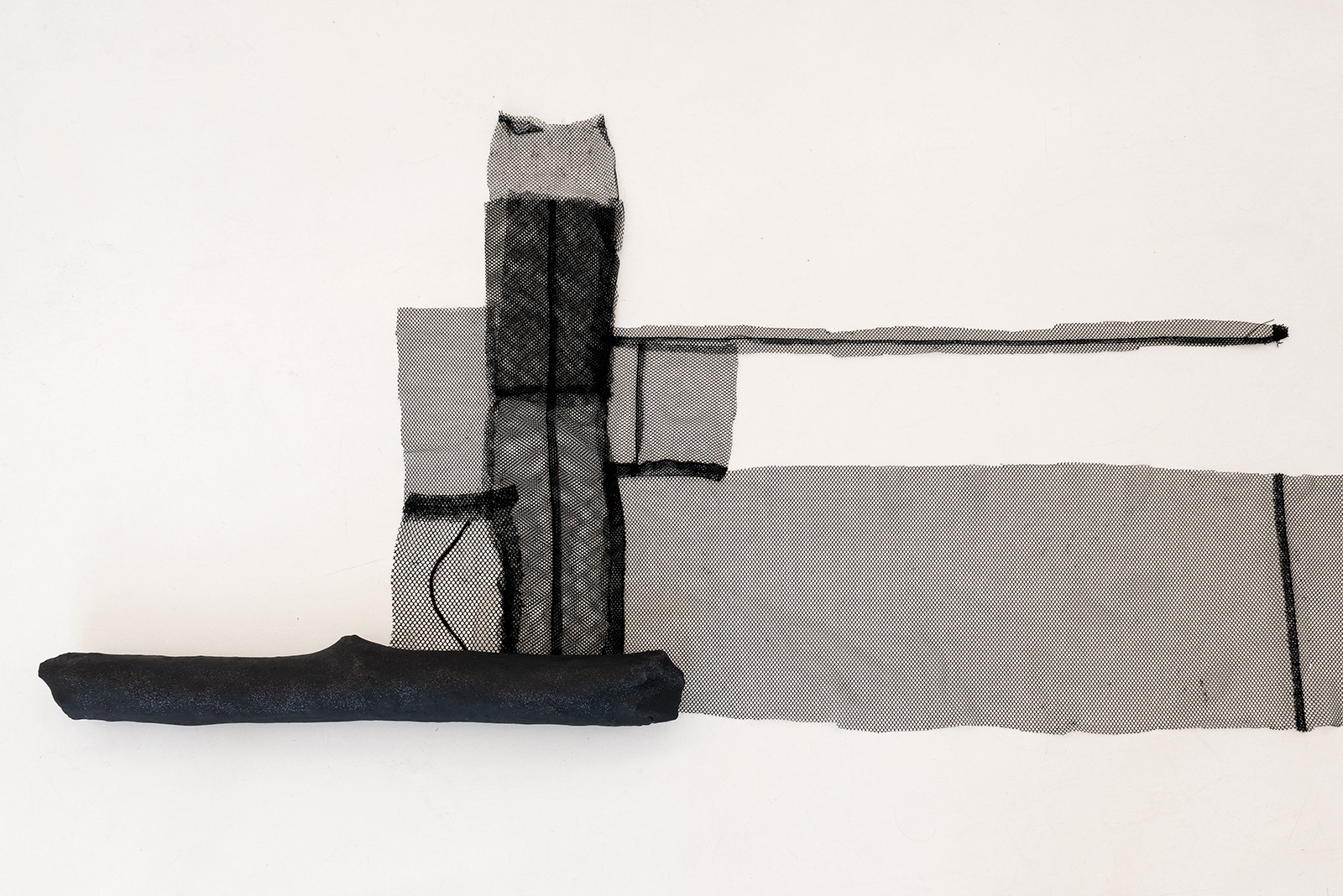(Erste) Liebe
I Shoppi Tivoli
Zu Beginn unserer Freundschaft, da waren wir ungefähr siebzehn, hingen Jascha und ich viel im Shoppi Tivoli herum. Das Shoppi Tivoli ist ein Einkaufszentrum in Spreitenbach im Aargau, wir wohnten beide in Fahrraddistanz davon entfernt. Es wurde in den 1970er Jahren gebaut, damals gab es ein Inserat in der Neuen Zürcher Zeitung mit der Überschrift: «Wir bauen ein Paradies», und das war es für uns ja auch.
Wir trafen uns schon am Samstagvormittag und tranken Kaffee auf der Treppe vor dem Shoppi. Ich fing wegen Jascha mit dem Kaffeetrinken an. Am Nachmittag bei Hitze teilten wir uns auf derselben Treppe eine Schachtel Kirschen. Manchmal, wenn es schon Abend war, reichten wir uns an der Bushaltestelle noch eine Tüte Pommes hin und her, und Jascha überliess mir die letzten auf dem Boden der Tüte, die, die am salzigsten sind.
Wir berieten uns beim Kauf von Kleidung. Einmal probierte ich ein Kleid an, violett, mit einem breiten Taillen-Gürtel. Es war figurbetont, ein Woll-Polyester-Gemisch, die Farbe ein wenig grell, von New Yorker.
Ich drehte mich einmal um meine eigene Achse. Das gefällt dir wohl nicht, sagte ich. Doch, sagte Jascha, doch, ich mag es. Ich dachte, solche Dinge sind nicht so deins, sagte ich.
Sind sie auch nicht, sagte Jascha. Ich mag sie an dir, nicht an mir.
Jascha und ich waren zwei Pole. Anfangs hatte ich das Gefühl, ich müsste mich Jaschas Pol annähern, damit Jascha mich mochte. Aber dann merkte ich, dass Jascha mich an meinem Pol sehen konnte und es mochte, dass ich dort war.
Jascha mochte die weiche Wolle meiner Strickjacke und den Polyester meiner Röcke und Oberteile. Ich mochte die schwere Baumwolle der Bandshirts, die Jascha trug.
Ich hatte Freude an der Künstlichkeit, der Verfremdung. Auf der Klassenfahrt in Neuchâtel kaufte ich mir bei Metro ein kleines Latextäschchen mit der Aufschrift «Bitch». Wenn ich es im Bus vom Dorf in die Stadt trug, machten die Männer Sprüche. Jascha stand neben mir, fing an, über etwas anderes zu reden, und hielt meine Hand.
Jascha nahm mich zu Punk-Konzerten mit, die mir gefielen. Ich sprach nicht davon, welche Musik ich allein auf dem CD-Player hörte, wenn ich abends in meinem 90er-Bett lag: I talked to your dad, go pick out a white dress.
Ich merkte schnell, dass ich Jascha immer schreiben konnte, zu jeder Tag- und Nachtzeit, und immer eine Antwort bekam. Jascha trug das Handy immer in Hosentasche. Bei mir war das damals noch anders. Mein rotes Tastenhandy war noch kein Teil meines Körpers.
Einmal, als wir im Shoppi Tivoli auf der Passage auf einer Bank sassen und Eis assen, spielten die Lautsprecher den Song, den aus meinem Zimmer. Er war damals überall. Ich sang leise mit. Als ich zu Jascha hinüberschaute, sah ich plötzlich, dass Jascha dasselbe tat. Wir konnten beide den ganzen Text auswendig.
Ich übernachtete einige Male bei Jascha, und jede Nacht rückten wir ein wenig näher. In der dritten küssten wir uns, und dann küssten wir uns die ganze Nacht. In den Wochen danach bekam ich immer Herzklopfen, wenn ich Jaschas Pantene-Pro-V-Shampoo bei jemandem roch, dabei war dieses Shampoo damals sehr verbreitet und beliebt.
II Möwenpick / Fressbalken
Die Autobahnraststätte in unserem Dorf befindet sich am Fuss eines kleinen, waldbedeckten Hügels, ein kleiner Spaziergang vom Dorfinneren entfernt. Das bedeutet, wenn du im Wald spazieren gehst, hörst du die Autobahn rauschen. Ich habe in diesem Wald Fahrrad fahren gelernt. Als ich das dann konnte, hat meine Oma mich auf Ausflüge zur Raststätte mitgenommen. Der steile Abhang am Schluss war die Belohnung. Dann gingen wir in die Autobahnraststätte, das Möwi, das sich als Brücke von einer Seite der Autobahn zur anderen erststreckt. In der Mitte der Brücke, gleich an den Panoramafenstern, die Möwenpick-Eisdiele. Wir holten uns beide ein Schälchen Eis, setzten uns auf die hohen Barhocker am Fenster, schauten auf die Rücken der Autos hinunter und fragten uns, wo sie hinfuhren. Seltsamerweise fuhren sie in meinem Kopf immer in den Urlaub, Südfrankreich, Toskana, Istrien.
Mit neunzehn verbrachte ich den letzten Sommer in unserem Dorf. Im Herbst, der mir unendlich weit weg vorkam, würde mein Studium beginnen. An einem warmen Sonntagabend spazierten Jascha und ich los vom Haus meiner Eltern bis zum Möwenpick hinunter, etwa eine halbe Stunde Fussweg. Es war Sonntag und die normalen Läden hatten geschlossen. Wir kauften ein, ich weiss noch, wie erwachsen ich mich fühlte, weil Jascha die teuren Steinpilz-Tortellini aus dem Kühlregal aufs Band legte, als wäre es ein ganz besonderer Tag. Ich dagegen: zwei Becher Schokoladenpudding und Zigaretten. Wir hielten uns an den Händen auf dem Weg durchs Möwenpick, machten verschämte Witze über den Erotikshop Magic X. Auf dem Spielplatz legten wir uns in die Korbschaukel, ich rauchte eine Zigarette. Wir gingen mit Plastiktüten in den Händen zurück durch den Wald.
Eine Raststätte ist immer etwas zutiefst Sentimentales und Melancholisches, ein Ort der Sehnsucht nach der Ferne, ein Ort der Durchreise. Ein Ort der Tristesse nur für Leute, die ihn nicht kennen. Ein Fenster zur Welt.
Auf dem Weg nach Hause wollte ich, dass Jascha ein paar Fotos von mir machte, in meinem weissen Sommerkleid vor dem dunkelgrünen Sommerwald, ich lehnte mich an die Stämme und schaute immer an der Handykamera vorbei in die Ferne wie Taylor Swift in den Videos.
Jascha zeigt mir, während wir Steinpilztortellini essen – Jascha spiesst immer ein ganzes mit der Gabel auf und schiebt es sich in einer fliessenden Bewegung in den Mund – auf meinem Laptop Youtube-Videos von Rose and Rosie. Jascha erzählt mir: Ich schaue die seit Jahren. Und Jascha erzählt mir von anderen lesbischen Youtube-Pärchen, wer sich kürzlich getrennt hat und warum. Wir schauen uns Rose and Rosies Hochzeit zusammen an, und ich muss ein bisschen weinen.
Als wir uns trennen, klingelt Jascha an der Haustür meiner Eltern und bringt mir einen Stapel Klamotten mit, die ich im Billy-Regal neben Jaschas Bett gelagert hatte, darunter das violette Pulloverkleid. Ich gab Jascha ebenfalls einige T-Shirts und Pullis zurück, aber nicht das H&M-Shirt von Nirvana, das wir zusammen im Tivoli gekauft hatten.
III Letzipark
Jascha und ich trennten uns, bevor wir richtig erwachsen wurden. Wir gingen nahtlos von einer Beziehung in eine Freundschaft über.
Wir waren Teil einer Gruppe von Freunden, die alle wegwollten. Wir zogen zusammen mit zwei anderen Freunden in eine alte, befristete Wohnung am Rande der Stadt.
In den ersten Wochen nach unserem Einzug schliefen wir alle im Wohnzimmer, Jascha, die beiden anderen und ich. Wir waren eingezogen, wir hatten ein Mobility-Auto gemietet, der Tag war lang gewesen, wir waren aufgekratzt, müde und wie betrunken von unserer Unabhängigkeit und von allem, was uns bevorstand. Wir zogen an die Stadtgrenze zwischen Zürich und Schlieren, auf die Zürcher Seite, also: in die Stadt. Unsere Wohnung lag in einer Häuserzeile mit niedrigen Decken und bedeckten Balkonen. Wir hatten einen grünen Innenhof, es gab viele Katzen. Wir wohnten in der Nähe des Briefsortierzentrums Mülligen. Wir wohnten an der Tramlinie 2.
Wir waren es gewohnt, zu viert im gleichen Zimmer zu schlafen, vielleicht wollten wir das deshalb machen in unserer ersten Nacht und auch die Nächte darauf: Weil wir es all die vergangenen Jahre so getan hatten, wir hatten ständig beieinander übernachtet, weil irgendjemand nicht mehr nach Hause gekommen war. Die Jahre in Bussen und Regionalzügen und Bars, im Shoppi Tivoli und im Möwenpick und in dem einen Café unten am Fluss, in dem wir alle einmal gearbeitet hatten; die Jahre – auf den Bahnsteigen, neben denen die Züge unglaublich schnell vorbeifuhren, wenn ich an zu Hause denke, denke ich nur an dieses Geräusch von einem vorbeirasenden Schnellzug, nicht zu nahe an die Schiene stehen. Wir waren plötzlich in unserer eigenen Wohnung, wir waren in der Stadt (knapp), wir waren Hochstapler, es war eine subventionierte Wohnung und befristet auf zwei Jahre, aber wer weiss schon, was in zwei Jahren ist.
Die Wohnung hatte vier Zimmer und eine Küche und ein Bad, einen kleinen überdachten Balkon, in der Küche einen Gasherd und eine Neonlichtröhre darüber. Jascha hängte Bandposter und Kunstplakate auf, räumte all die mir vertrauten Dinge ins Billy-Regal, Hoodies, bedruckte Socken, das eine Shirt für besondere Anlässe, englische Bücher, Graphic Novels und Bildbände.
Am ersten Februarwochenende war es sonnig, die ersten warmen Tage, die Autos auf der Badenerstrasse kurbelten die Scheiben runter, Männer zogen verwundert die Pullis über den Kopf und sonnten sich in schwarzen T-Shirts vor den Imbissen am Strassenrand. Nach zwei Wochen in der Stadt hatten wir alle unsere Fahrräder im Innenhof angeschlossen, unsere Spiegel an die Wand gehängt, unsere IKEA-Kleiderstangen aufgestellt. Uns fehlte es an kleinen Dingen, an die wir bisher nicht gedacht hatten: Dübel, Klebband, Edding, Salatbesteck, Glasreiniger, Kerzen, ein Kissenbezug. Also machten wir einen Ausflug ins Einkaufszentrum Letzipark. Wir stiegen auf unsere Fahrräder, laut Google Maps dauerte es acht Minuten, alles die Badenerstrasse runter in Richtung Stadt. Wir besuchten den riesigen Coop und kauften teure Lebensmittel. Wir besuchten Manor und kauften einen Kerzenständer. Wir gingen in die Männerabteilung von H&M und ich beriet Jascha beim Kauf eines Jacketts. Wir fühlten uns wie zuhause.
Dann gingen wir alle zusammen ins Coop-Restaurant und assen Kuchen und tranken Caotina. Danach war es draussen dunkel. Als wir gemeinsam unsere Fahrräder aufschlossen, bemerkten wir, dass wir zu viel gekauft hatten, um alles auf ihnen zu transportieren. Wir mussten die Fahrräder schieben. Es wurde kalt auf dem Weg und wir waren müde.
Am selben Abend wollte ich unbedingt noch ausgehen, und wir nahmen den Bus Richtung Innenstadt, Richtung Langstrasse. Wir standen eine halbe Stunde Schlange vor einem Club und zahlten zu viel Eintritt, deshalb konnten wir uns keine Getränke mehr leisten. Wir tanzten, oder wippten eher, wir wussten die Bewegungen zur Musik nicht, ich fühlte mich beobachtet, mein Rock, meine Stiefel mit Absatz erschienen mir albern im Vergleich zu den Klamotten der anderen Leute, die grosse schwarze Shirts und knöchelfreie Hosen trugen. Als ich von der Toilette zurückkam und Jascha mit einer anderen Frau knutschte (schwarzes Shirt, knöchelfreie Hose), lief ich nach draussen, setzte mich vor dem Eingang des Clubs auf den Bürgersteig und weinte wie in einem Film. Einer unserer Mitbewohner kam raus, setzte sich neben mich und zündete sich schweigend eine Zigarette an.
Im Nachtbus nach Hause legte Jascha den Arm um mich. Wir sprachen nie mehr darüber, warum ich geweint hatte. Aus schlechtem Gewissen briet ich am nächsten Morgen Pfannkuchen für alle; ich verzierte sie mit bunten Streuseln, die ich in den Tiefen des Letziparks gefunden habe. Danach machten wir zu viert einen Spaziergang an der Sonne und streichelten die Katzen im Innenhof. Ich balancierte auf allen Mäuerchen und stützte mich auf Jaschas Schulter ab. Ich fühlte mich frei und glücklich wie ein Kind.
Wir zeigten auf die Häuser im Quartier, sagten: Schau, ein Hallenbad, hier können wir mal schwimmen gehen; ein Ortsmuseum, das wir mal besuchen können; eine Bar, ein Kebabstand, eine Gelateria. Eine Autogarage, ein Matratzengeschäft. Ich finde in einem Umzugskarton das Nirvana-Shirt von Jascha, das ich seit Jahren zum Schlafen trage; am nächsten Tag falte ich es und lege es in Jaschas Zimmer aufs Bett.
(Premier) amour
I Shoppi Tivoli
Au début de notre amitié, on devait avoir à peu près 17 ans, Jascha et moi traînions souvent au Shoppi Tivoli. Le Shoppi Tivoli est un centre commercial à Spreitenbach en Argovie, on pouvait y aller à vélo depuis le village où on habitait. Il a été construit dans les années septante; à l’époque il y avait eu une annonce dans la Neue Zürcher Zeitung ; elle portait le titre Nous construisons un paradis et pour nous, c’en était un.
On se retrouvait le samedi matin pour boire un café sur l’escalier devant le Shoppi. C’est avec Jascha que j’ai commencé à boire du café. L’après-midi, quand il faisait chaud, on se partageait une boîte de cerises sur le même escalier. Parfois, le soir, on se passait un cornet de frites et Jascha me laissait les dernières frites du fond, les plus salées.
On se conseillait pour acheter des habits. Une fois, chez New Yorker, j’essayai une robe violette, avec une large ceinture à la taille. Elle était près du corps, d’un mélange de laine et de polyester, un peu criarde.
Je fais un tour sur moi-même. Tu n’aimes pas, dis-je. Si, dit Jascha, si, j’aime bien. Je croyais que ce genre de choses n’étaient pas trop ton style, dis-je. Et c’est vrai, dit-iel. Je les aime bien sur toi, par sur moi.
Jascha et moi étions deux pôles. Au début j’avais l’impression que je devais me rapprocher du pôle de Jascha pour qu’iel m’apprécie. Mais plus tard je remarquai que Jascha pouvait me voir à ma propre place et aimait bien que je sois ce pôle-là.
Jascha aimait la laine douce de mes vestes en tricot et le polyester de mes jupes et mes hauts. J’aimais la laine lourde des t-shirts de groupes de rock que Jascha portait.
J’avais du plaisir à jouer avec l’artifice, le détournement. Lors d‘un voyage de classe à Neuchâtel, je m’étais acheté chez Metro un petit sac en latex avec le mot Bitch dessus. Quand je le portais dans le bus qui allait du village à la ville, les hommes me faisaient des commentaires. Jascha se tenait à côté de moi, commençait à parler d’autre chose et me tenait la main.
Jascha m’amenait à des concerts de punk qui me plaisaient aussi. Je ne lui parlais pas de la musique que j’écoutais toute seule sur mon lecteur de CD le soir, dans mon lit de nonante centimètres : I talked to your dad, go pick out a white dress.
Rapidement, je remarquai que je pouvais toujours écrire à Jascha, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. A chaque fois je recevais une réponse. Jascha portait toujours son portable dans la poche de son pantalon. Pour moi, c’était différent : mon portable à touches n’était pas encore une partie de mon corps.
Une fois, au Shoppi Tivoli, alors qu’on mangeait une glace sur un banc du passage, la chanson, celle que j’écoutais dans ma chambre, commença à retentir des haut-parleurs. On l’entendait partout à l’époque. Je me mis à chanter doucement avec. Quand je regardai vers Jascha, je vis soudainement qu’iel faisait pareil. On connaissait les deux le texte entier par coeur.
Je dormis quelques fois chez Jascha, et chaque nuit on se rapprochait un peu plus. La troisième nuit on s’embrassa, et ensuite on s’embrassa toute la nuit. Les semaines qui suivaient, mon coeur commençait toujours à battre quand je reconnaissais l’odeur du shampoing Pantene-Pro-V de Jascha sur quelqu’un. C’était pourtant un shampoing très répandu et populaire à l’époque.
II Möwenpick
Dans notre village, l‘aire d‘autoroute se trouve au pied d’une petite colline recouverte de forêt, à juste une petite promenade depuis le centre du village. Donc quand tu te promènes en forêt, tu entends le bruit de l’autoroute. C’est dans cette forêt que j’ai appris à faire du vélo. Une fois que je savais en faire, ma grand-mère m’amenait parfois faire des escapades sur l’aire d’autoroute. Il y avait une pente raide à la fin du chemin, et c‘était la récompense. On allait ensuite à l’aire d’autoroute, qu’on appelait le Möwi et qui forme un pont d’un côté de l’autoroute à l’autre. Au milieu du pont, à côté du panorama, il y avait un marchand de glace Möwenpick. On prenait chacune un petit gobelet de glace, on s’asseyait sur les hauts tabourets de bar à la fenêtre, on regardait le dos des voitures en bas et on se demandait où elles allaient. Dans ma tête, bizarrement, les voitures allaient toujours en vacances : au Sud de la France, en Toscane, en Istrie.
J’avais dix-neuf ans quand j’ai passé mon dernier été dans notre village. En automne, saison qui me paraissait infiniment lointaine, j’allais commencer mes études. Lors d’un dimanche soir où il faisait chaud, Jascha et moi marchions depuis la maison de mes parents jusqu’au Möwenpick, à environ une demi-heure à pied. On avait fait du shopping et je me souviens encore de m’être sentie si adulte quand Jascha avait posé l’assiette hors de prix de tortellini aux bolets du rayon frais sur le tapis roulant, comme si la journée était particulièrement spéciale. Pour moi par contre, c’était deux flancs au chocolat et des cigarettes. On se tenait la main à travers le Möwenpick, on se faisait des blagues gênées sur le magasin érotique Magic X. Sur la place de jeu, on s’allongea dans une balançoire en osier, je fumai une cigarette. On rentra avec des sacs en plastique dans les mains à travers la forêt.
Une aire d’autoroute est toujours un lieu profondément sentimental et mélancolique, un lieu de nostalgie du lointain, un lieu de passage. Une fenêtre sur le monde. L’aire d’autoroute est un lieu de tristesse seulement pour les gens qui ne la connaissent pas.
Sur le chemin de la maison, je voulais que Jascha prenne quelques photos de moi, dans ma robe d’été blanche devant la forêt estivale verte foncée, je m’appuyais aux troncs des arbres et regardais toujours au loin, à côté de la caméra, comme Taylor Swift dans sa vidéo.
Pendant qu’on mange des tortellini aux bolets – Jascha arrive toujours à piquer une grande bouchée avec sa fourchette et à se la mettre dans la bouche en un seul mouvement fluide – Jascha me montre des vidéos YouTube de Rose and Rosie sur mon ordinateur portable. Iel me raconte : Je regarde ça depuis des années. Et iel me parle d’autres couples lesbiens de YouTube, de ceux qui se sont séparés récemment, et pourquoi. Quelques mois plus tard, on regarde ensemble le mariage de Rose and Rosie et je pleure un peu.
Quand on s’est séparés, Jascha sonna à la porte de chez mes parents et me rapporta une pile de fringues que j’avais stockés dans l’étagère Billy à côté de son lit, y compris la robe-pull violette tout en bas. Je lui rendis aussi quelques t-shirts et pulls, mais pas le t-shirt H&M de Nirvana qu’on avait acheté ensemble au Tivoli.
III Letzipark
Jascha et moi nous sommes séparés avant de devenir vraiment adultes. On a passé de manière fluide d’une relation amoureuse à une amitié.
On faisait partie d’un groupe d’amis qui voulaient tous partir. On emménagea tous ensemble dans un appartement loué pour une durée déterminée en périphérie de la ville.
Lors des premières semaines de notre emménagement, on dormait tous ensemble dans le salon, Jascha, les deux autres et moi. On avait emménagé, on avait loué une voiture avec Mobility, la journée avait été longue, on était survoltés, fatigués et comme ivres de notre indépendance et de tout ce qui nous attendait. On avait emménagé au bord de la ville, entre Zurich et Schlieren, du côté de Zurich, soit: en ville. Notre appartement faisait partie d’une ligne de maisons avec des plafonds bas et des balcons couverts. On avait une cour intérieure verte où il y avait beaucoup de chats. On habitait près du centre de tri postal de Müllingen. On habitait sur la ligne du tram 2.
On était habitués à dormir à quatre dans la même pièce, c’est peut-être pour ça qu’on voulait faire ça la première nuit et les nuits d’après : parce qu’on avait tout le temps fait comme ça les années d’avant, on dormait constamment les uns chez les autres parce que je ne sais qui ne pouvait plus rentrer chez soi. Ces années dans les bus, les trains régionaux et les bars, au Shoppi Tivoli et au Möwenpick et au café en bas vers le fleuve où on avait tous travaillé une fois; ces années – sur les quais de gare au bord desquels les trains passent incroyablement vite. Quand je pense à chez moi, je ne pense qu’à ce bruit d’un train à grande vitesse qui roule à toute allure, à ne pas se tenir trop près de la voie. On était soudainement dans notre propre appartement, on habitait (presque) en ville, on était des imposteurs, c’était un appartement subventionné, son bail était limité à deux ans, mais qui savait où l’on en serait d’ici deux ans.
L’appartement avait quatre pièces, une cuisine et une salle de bain, un petit balcon couvert, et dans la cuisine une cuisinière à gaz avec un tube de néon au-dessus. Jascha colla ses posters de musique et ses affiches d’art au mur et rangea toutes ses affaires que je connaissais bien dans l’étagère Billy : pulls à capuche, chaussettes imprimées, le t-shirt pour les occasions particulières, ses livres en anglais, bande-dessinées et albums photo.
La dernière semaine de février, il faisait un temps ensoleillé, c’étaient les premières journées chaudes, les voitures baissaient leur vitre sur la Badenerstrasse, les hommes enlevaient leurs pulls en les glissant sur leur tête l’air surpris et bronzaient dans des t-shirts noirs devant les bistrots et kiosques du bord de la rue. Après deux semaines en ville, on avait déjà tous rangé nos vélos dans la cour intérieure, suspendu nos miroirs au mur, montés nos barres de vêtements IKEA. Il nous manquait des petites choses auxquelles on n’avait pas encore pensé : des chevilles pour les vis, du scotch, des stylos indélébiles, des services à salades, du détergent pour vitres, des bougies, une taie d’oreiller. On fit alors une excursion de groupe au centre commercial Letzipark. On prit nos vélos ; le trajet durait huit minutes d’après Google Maps ; tout droit sur la Badenerstrasse direction la ville. On fit un tour dans l’immense Coop et on acheta des aliments chers. On alla chez Manor et on acheta un chandelier. On alla au rayon pour homme de H&M et je conseillai Jascha qui voulait s’acheter un blouson. On se sentait comme à la maison.
On alla ensuite tous ensemble au restaurant de la Coop pour manger du gâteau et boire du Caotina. Puis il se fit sombre dehors. Lorsqu’on ouvrit les cadenas de nos vélos, on réalisa qu’on avait acheté trop de choses pour tout transporter en roulant. On avait dû pousser nos vélos. On avait eu froid sur le chemin, on était fatigués.
Le même soir, je voulais absolument sortir et on prit tous le bus en direction du centre-ville, direction Langstrasse. On fit la queue pendant une demi-heure à l’entrée d’une boîte où on paya l’entrée trop cher, donc on pouvait plus se permettre de s’acheter des boissons. On dansa, ou plutôt on se balança – on ne savait pas trop comment danser sur cette musique, je me sentais observée, ma jupe, mes bottes à talons me paraissaient ridicules à côté des fringues des autres gens, tous en grands t-shirts noirs et en pantalons sans cheville. Quand je revins des toilettes et que Jascha flirtait avec une autre fille (t-shirt noir, pantalon sans cheville), je sortis et m’assis devant l’entrée de la boîte sur le trottoir et pleurai, comme dans un film. L’un de nos colocataires sortit aussi, s’assit à côté de moi et s’alluma une cigarette sans rien dire.
Dans le bus de nuit, Jascha passa son bras autour de moi. On ne parla jamais de pourquoi j’avais pleuré. Le lendemain, par mauvaise conscience, je fis des crêpes pour tout le monde ; je les décorai avec des flocons multicolores que j’avais trouvés dans les tréfonds du Letzipark. On fit une promenade à quatre au soleil, on caressa les chats dans la cour intérieure. Je marchais en équilibre sur les murets et m’appuyais sur l’épaule de Jascha. Je me sentais libre et heureuse comme un enfant.
On se montrait les bâtiments du quartier, on se disait : regarde, une piscine municipale, on pourrait y aller nager une fois; regarde, un musée local, on pourrait le visiter; un bar, un kebab, une gelateria. Un garage automobile, un magasin de matelas. Dans un carton de déménagement, je trouve le t-shirt Nirvana de Jascha que je porte depuis des années comme pyjama; le jour suivant, je le plie et le dépose dans la chambre de Jascha sur son lit.
Photo: Julien Gremaud